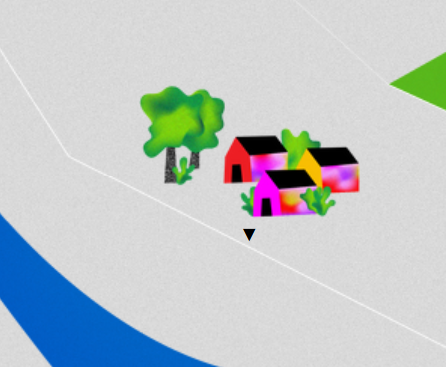 Überall auf der Welt hat die Corona-Pandemie – wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen – den grundlegenden Widerspruch zwischen einer profitgetriebenen Produktionsweise und der sozialen Reproduktion aufgezeigt – den Konflikt Kapital-Leben (s. SOF/XXK). Die Unterfinanzierung der öffentlichen Gesundheitssysteme und fortschreitenden Privatisierungen von sozialer Infrastruktur sind Ausdruck dieses Profitstrebens in allen Bereichen des Lebens und gehören zu den Ursachen für die in vielen Ländern explodierte Zahl der Todesopfer, auch in Lateinamerika. Damit wird allerdings auch schon deutlich, dass die Pandemie und ihre politische Bearbeitung zwar den Konflikt Kapital-Leben noch offensichtlicher gemacht hat, dieser aber nicht neu, sondern einintegraler Teil des kapitalistischen Systems ist.
Überall auf der Welt hat die Corona-Pandemie – wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen – den grundlegenden Widerspruch zwischen einer profitgetriebenen Produktionsweise und der sozialen Reproduktion aufgezeigt – den Konflikt Kapital-Leben (s. SOF/XXK). Die Unterfinanzierung der öffentlichen Gesundheitssysteme und fortschreitenden Privatisierungen von sozialer Infrastruktur sind Ausdruck dieses Profitstrebens in allen Bereichen des Lebens und gehören zu den Ursachen für die in vielen Ländern explodierte Zahl der Todesopfer, auch in Lateinamerika. Damit wird allerdings auch schon deutlich, dass die Pandemie und ihre politische Bearbeitung zwar den Konflikt Kapital-Leben noch offensichtlicher gemacht hat, dieser aber nicht neu, sondern einintegraler Teil des kapitalistischen Systems ist.
Gleichzeitig hat Corona einmal mehr ins Bewusstsein gerufen, welche gesellschaftlichen Arbeiten im engen Sinne „systemrelevant“ sind. Neben der Gesundheitsversorgung sind dies vor allem Pflege, Erziehung, Bildung, Ernährung, Reinigung und Betreuung – all jene Tätigkeiten also, die traditionell von Frauen und zu großen Teilen im privaten Haushalt erledigt werden. Und zwar häufig auf Kosten ihrer (ökonomischen) Selbstständigkeit und persönlichen Entwicklungschancen. Diese geschlechtliche Arbeitsteilung, die die binäre Anordnung von Geschlecht erst nach sich zieht, ist damit eine wesentliche Grundlage hierarchischer Geschlechterverhältnisse.
Manche können die hier offensichtlich werdenden Löcher in der öffentlichen Infrastruktur dadurch stopfen, dass sie sich Care-Dienstleistungen auf dem Markt einkaufen, aber viele und immer mehr müssen sich angesichts steigender Preise und zunehmender Prekarisierung und Armut auf die Arbeit in der Familie oder den sozialen Netzwerken verlassen. Die finanziellen und die emotionalen Kosten werden in beiden Fällen privatisiert.
Eine echte Lösung kann es nur geben, wenn Sorgearbeit vergesellschaftet und demokratisch organisiert wird. Erste Schritte in diese Richtung lassen sich am besten lokal erstreiten, dort wo Menschen sorgen und Sorge empfangen. Kein Wunder, dass es vielerorts bereits Suchbewegungen nach einer lokalen, bedürfnisorientierten und demokratischen Organisation von Sorgearbeit gibt. Dabei geht es darum, die vermeindlich „privaten“ Probleme der Sorgearbeit als gesellschaftliche Aufgabe zu akzeptieren und mit den notwendigen Mitteln auszustatten, sowie die Infrastruktur des öffentlichen Raums entsprechend umzugestalteten.
Wie sähe eine Stadt aus, die die Bedürfnisse all ihrer Bewohner*innen (insbesondere der heute oft Vergessenen) ins Zentrum stellt – eine „Sorgende Stadt“? Welche Maßnahmen wären dafür auf den verschiedenen Regierungsebenen (national, regional, kommunal) erforderlich? Wie kann eine basisdemokratische Mitbestimmung aussehen?
Ansätze für Sorgende Städte in Südamerika
In Lateinamerika finden insbesondere auch im Anschluss an die erstarkenden feministischen Mobilisierungen verstärkt Debatten um Sorgeverhältnisse und die Bedingungen sozialer Reproduktion statt. Sie schlagen sich teils in kommunalen, teils in bundesstaatlichen Politiken nieder. In Valparaíso wie auch in anderen Städten Chiles konnten etwa durch die Selbstorganisierung von Nachbar*innen in Zusammenarbeit mit der linken Stadtverwaltung Apotheken eingerichtet werden, in denen wichtige Medikamente weit unterhalb des Marktwerts angeboten werden (s. Interview mit Ana Victoria Nieto). In einem ähnlichen Zusammenspiel von Initiativen von unten und linker Politik in Institutionen wird im argentinischen Rosario derzeit eine ehemals informelle und von Räumung bedrohte Siedlung zu einem voll angebundenen Stadtteil mit Wasseranschluss, Kanalisation und Internet sowie sozialer Infrastruktur (wie Schulen, Parks und Sportplatz) ausgebaut. Finanziert wird dies aus Mitteln des Bundes, die aus einer einmaligen Abgabe auf große Vermögen stammen, die die Regierung von Alberto Fernández während der Pandemie erhoben hat. Entworfen, geplant und begleitet wird das Projekt von den Bewohner*innen in Kooperation mit der dezidiert feministischen Bewegungspartei Ciudad Futura, die im Stadt- und Landesparlament vertreten ist.
An vielen Orten geht es um ein Zusammenspiel von Selbstermächtigung, Organisierung, Mitbestimmung, Infrastrukturen und staatlichen Programmen, die die Inititaiven unterstützen und finanzieren. Es geht darum, Ressourcen umzuverteilen, statt Selbstverwaltung, wie so oft, lediglich mit dem Ziel zu initiieren, staatliches Versagen oder Lücken über kostengünstige Alternativen zu kompensieren. So können auch andere Ebenen staatlicher Politik miteinbezogen werden, sei es bei Initiativen zur Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit oder bei Transfer- oder Rentenleistungen, die auf unterschiedliche Art die Möglichkeiten für Sorgetätigkeiten beeinflussen.
In Ländern wie Uruguay oder Argentinien wurde und wird daher von den Mitte-links-Regierungen auch auf Bundesebene an „integrierten Sorgestrukturen“ (Sistemas integrales de Cuidados) gearbeitet. Bestehende Angebote werden ausgebaut und besser verzahnt. Indem unbezahlte Sorgearbeit mitberücksichtigt wird, können die Angebote einerseits passgenauer gestaltet und andererseits Defizite ausgeglichen werden. In Uruguay wurden in diesem Zusammenhang etwa eine Zeitverwendungsstudie in Auftrag gegeben, die häusliche Care-Arbeit einschließt, eine Kampagne zur geschlechtlichen Arbeitsteilung initiiert und die unbezahlte Sorgearbeit in ein erweitertes Bruttoinlandprodukt eingerechnet, um zunächst öffentliche Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie wichtig Sorgearbeit für die Gesellschaft und wie sehr diese als „Frauenarbeit“ abgewertet ist (s. dazu die Studie zum Care-System in Uruguay).
Aber auch in Uruguay wird der Fokus auf die kommunale Ebene gerichtet. Teils geschieht dies unter dem Begriff der „Sorgenden Städte“ und im Austausch mit Verbündeten aus Barcelona, wo dies auch ein erklärtes Ziel der Stadtregierung darstellt.
Rebellisches Regieren in Barcelona
Die linke Stadtregierung von Barcelona en Comú legte 2017 als eine wesentliche Säule ihres „rebellischen Regierens“ ein „Maßnahmenpaket für eine Demokratisierung der Sorge in der Stadt Barcelona“ vor.
Um einen echten Paradigmenwechsel auch mit Blick auf das Verwaltungshandeln zu ermöglichen, siedelte Bürgermeisterin Ada Colau die Ausarbeitung des Maßnahmenpakets strategisch nicht im Bereich Feminismus an, sondern übertrug sie dem Dezernat für „Gemein-, Sozial- und Solidarwirtschaft“, der eng mit dem Bereich „Arbeit- und Wirschaftspolitik“ kooperierte. Auch wirtschaftspolische Maßnahmen sollten entsprechend über Fragen der Unternehmens- und Arbeitsmarktpolitik hinausgehen, auf den gesamten (auch unentlohnten) Care-Sektor ausgeweitet werden und Ansätze einer solidarischen Ökonomie, der Selbstorganisierung und von Genossenschaften privilegieren. Unter Beteilung aller anderen betroffenen Ressorts sollte ein „Präzedenzfall für eine öffentliche Sorgepolitik“ (Ezquerra/Keller 2022, 4) geschaffen werden, die Care-Arbeit auf die verschiedenen Akteure – also Staat, Markt, Privathaushalte und gemeinwirtschaftliche Strukturen – neu verteilt. Im Kern ging es darum, konkrete Verbesserungen im Alltag mit dem Fernziel einer geschlechtergerechten Sorge-Ökonomie zu verbinden.
Die meisten Projekte des 68 Einzelmaßnahmen umfassenden Plans betreffen eine „Vergesellschaftung der Sorgearbeit“ (ebd., 16) und sind darauf gerichtet, neue öffentliche Infrastrukturen wie Familienzentren und Krippen zu schaffen, bestehende auszubauen und den Zugang für vulnerable Gruppen zu erweitern. Eine neu eingeführte „Care-Karte“ (tarjeta cuidadora) entlastet Menschen mit besonderer häuslicher Sorgeverantwortung durch einen privilegierten Zugang zu städtischen Sorge-Infrastrukturen und sozialen Diensten. Und über veränderte Vergaberichtlinien soll auch auf private Träger insbesondere in der Altenpflege eingewirkt werden, um die dortige Qualität der Pflege und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Schließlich wurde – um diesen Umbau konkret anzuleiten und entsprechend durch Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten – in jedem Stadt-Bezirk eine Stelle für eine*n Fachreferent*in für Care-Ökonomie geschaffen.
Madrid, Stadt der Sorge
Ähnliche Ansätze verfolgten auch andere munizipalistische Stadtregierungen im Spanischen Staat. So verabschiedete in Madrid die von dem Parteienbündnis Ahora Madrid angeführte Linksregierung in ihrer Amtszeit (2015 bis 2019) einen ähnlichen Aktionsplan mit dem Titel „Stadt der Sorge“ (Ciudad del Cuidado 2015). Mit dem Ziel, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, setzte er ebenfalls darauf, die gesellschaftliche und kommunale Verantwortung für Sorgearbeit zu stärken. Neben einer Umverteilung von Sorgearbeit und einer Verbesserung der Angebote fokussierte der Plan insbesondere auf Fragen demokratischer Teilhabe und in diesem Sinne auch auf die Unterstützung lokaler Selbstorganisierung. Bereits bestehende soziale Praxen und Initiativen geteilter Sorgearbeit erhielten praktische Hilfe, um ihre Arbeit weiterzuentwickeln. Damit sollte außerdem das gesamte soziale Gefüge gestärkt werden, ausgehend von der Annahme, dass (basis)demokratische Entscheidungsprozesse und eine partizipative Bedarfsplanung als Momente einer „Sorgenden Stadt“ ohne ein solches nicht funktionieren können.
Der Madrider Aktionsplan umfasste außerdem verschiedene Projekte und Initiativen einer feministischen Stadtplanung. Eine geschlechter- und sorgesensible Gestaltung der Stadt transformiert auch die Nutzung des öffentlichen Raums, was wiederum Veränderungen im Alltag der Menschen und in ihren sozialen Beziehungen ermöglicht: Eltern lernen sich etwa auf dem Spielplatz kennen. Wenn dieser nicht in einem abgegrenzten Eck versteckt ist, sondern integraler Teil eines Stadtplatzes oder Parks, in dem es auch Angebote für andere Generationen und Interessengruppen gibt, kommen die Eltern auch mit Nachbar*innen und älteren Menschen in Kontakt. Breite und ausgeleuchtete Wege mit einsehbarer Begrünung geben Menschen, die in der Öffentlichkeit vermehrt Gewalt ausgesetzt sind, ein besseres Sicherheitsgefühl und damit mehr Bewegungsfreiheit. Dadurch entstehen auch andere soziale Beziehungen, die wiederum eine Basis sowohl für geteilte Sorgearbeit jenseits öffentlicher Infrastruktur als auch für direktdemokratische Mitbestimmung und Planung bilden können.
Bremen sorgt
Diese Beispiele aus verschiedenen Teilen der Welt inspirieren aktuell feministische und stadtpolitische Debatten in Deutschland. Ein konkretes Beispiel ist das Vorhaben der Partei DIE LINKE, Bremen zu einer Sorgenden Stadt zu machen. Dasmit rund 700.000 Einwohner*innen kleinste Bundesland Deutschlands, wird sit 2019 von der LINKEN mitregiert. Die sozialistische Partei ist gleichzeitig ein wichtiger Bündnispartner für soziale Bewegungen. Die Initiative trifft nicht auf unbeackertes Terrain. Seit einigen Jahren mehren sich in Bremen Proteste und Selbstorganisierungen rund um das Care-Thema: von gewerkschaftlichen Streiks in der Pflege oder Sozial- und Erziehungsdiensten, über Aktionsbündnisse für bessere Bedingungen in der Altenpflege, bis zu Medi-Büros, die illegalisierten Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung verschaffen. Von Stadtteil-Gesundheitszentren (Polikliniken), die auch die sozialen Faktoren von Gesundheit miteinbeziehen, bis hin zum feministischen Streik, der auch Privathaushalte umfasst. Zahlreiche von ihnen hatten sich bereits 2014 zur Aktionskonferenz Care Revolution zusammengefunden und ein Netzwerk gegründet, in dem lokale Aktionen zusammenfließen und überregionale Kampagnen angestoßen werden. Viele dieser konkreten Ansätze und Ideen könnten sich im Projekt einer „Sorgende Stadt“ zusammenfinden, das kurz- wie langfristig umzusetzende Maßnahmen umfasst, und solche, die gesellschaftsverändernden Charakter haben. Ideen und Vorschläge gibt es bereits viele: als „Einstiegsprojekte“ etwa die Forderung nach einer Rekommunalisierung privater Dienstleister in der Altenpflege oder nach einer kurzen Vollzeit mit Sechs-Stunden-Arbeitstagen in der Pflege als Einstiegsprojekt in eine tarifliche Arbeitszeitverkürzung auch in anderen Sektoren. Weiterhin wird der Ausbau von Gesundheits- und Nachbarschaftszentren mit Unterstützungsangeboten etwa für ältere Menschen oder Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche ebenso wie Räume für geteilte Sorgearbeit in Elterngruppen oder Gemeinschaftsküchen gefordert. Außerdem Maßnahmen, die eine Stadt für alle zugänglich machen, wie etwa ein kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr. Auch ein ein Krankenschein, der Menschen ohne Papiere einen Zugang zur Krankenversicherung ermöglicht wird diskutiert. Neben den sozial-politischen Forderungen, wird über eine Stadt nachgedacht, in der sich alle wohlfühlen, mit Grünflächen und breiten Wegen, mit Beleuchtungen in der Nacht und weiteren Maßnahmen gegen sexualisierte Belästigung im öffentlichen Raum und dem Verbot anlassloser Polizeikontrollen. In einer sorgenden Stadt muss auch die öffentliche Verwaltung so umgebaut werden, dass Geschlechtergerechtigkeit und die Gewährleistung guter Sorgeverhältnisse zu zentralen Kriterien ihres Handelns werden und kontinuierlich überprüft wird, ob öffentliche Angebote tatsächlich auch für alle zugänglich sind.
Welche Ideen für die jeweilige „Sorgende Stadt“ im Vordergrund stehen, und wie der Prozess der Umsetzung gestaltet werden soll, muss vor Ort diskutiert und entschieden werden.
In Bremen könnte es perspektivisch um die Gründung eines Care-Rates gehen, der die gemeinsame Ermittlung von Bedarfen und das Aushandeln von Interessen dauerhaft absichert. Er müsste organisierten Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, also auch eine demokratische Vermittlung zwischen Bewegungen und Parlamenten herstellen.
Für einen Internationalismus von unten
Diese – und viele weitere Beispiele – zeigen auf, wie an unterschiedlichen Orten ähnliche Strategien gegen die Krise der sozialen Reproduktion – den Konflikt Kapital-Leben – entwickelt werden. Es geht um Rekommunalisierung, um den Ausbau und den Zugang zu öffentlicher Infrastruktur und um basisdemokratische Mitbestimmung. Und es geht darum, auf diese Weise sowohl mit kapitalistischen Eigentumsverhältnissen zu brechen und gleichzeitig die geschlechtliche Arbeitsteilung zu überwinden.
Diese Projekte werden notwendigerweise lokal und von unten aufgebaut – aber können viel von gegenseitigem Austausch gewinnen. In Lateinamerika, das über eine langjährige Erfahrung sozialer Organisierung für Wohnraum und der Selbstverwaltung verfügt und einige der größten Städte der Welt beherbergt, werden heute interessante Vorschläge zur Verbindung von Sorge und Stadtentwicklung aus der Perspektive des Globalen Südens entwickelt. Es gilt nun, sich international zu vernetzen und über lokale Lösungen für ein globales Problem auszutauschen.
Wie wäre es, wenn es ein internationales Netzwerk von Sorgenden Städten gäbe?
Barbara Fried ist leitende Redakteurin der Zeitschrift LuXemburg und stellvertretende Direktorin des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie ist im Netzwerk Care Revolution aktiv und arbeitet zu Fragen von Sorgearbeit und Feminismus.
Alex Wischnewski arbeitet für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Programm Globaler Feminismus. Sie hat das Netzwerk Care Revolution und die Plattform #keinemehr mitgegründet und ist aktiv in der Partei Die LINKE.
